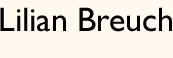 |

|
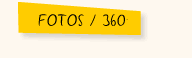 |
 |
 |
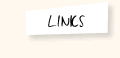 |
|
 |
 |
 |
 |
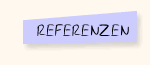
|
 |
Trekking La Gomera
Das pfiffige Palmenparadies

Vom LSD-Trip zum Wandertipp
Kaum zu glauben, dass inzwischen sportive Wanderfreaks die Insel erstürmen, denn vor nicht allzu langer Zeit stürmten ganz andere Freaks auf den schrullig grünen Atlantik-Zwerg. Ende der 60er trafen sich hier die Hippies der Berliner Szene, und selbst der Papa von der Lindenstraße träumte von einem Leben auf der „Isla Magica“. Als Wollmützenstricker natürlich. Von irgendwas muss man ja schließlich leben. Die Mühl-Kommune rief ihren eigenen Mini-Staat im Süden aus, und einige Bhagwan-Jünger machten es ihnen nach. Es musste doch was dran sein an diesem unentdeckten Paradies, wo es anscheinend keine Gesetze gab, kein Telefon und nicht mal Strom. Ein Gesetz gab es natürlich schon. Das höchste aller Hippie-Gesetze: Freie Liebe für alle. Zu befolgen: Täglich. Für die armen Gomeros ein absoluter Kulturschock. Da hausten diese langmähnigen Menschen am Playa de Arenal in Steinhöhlen, frönten dem Nacktbaden und betrieben wilde Sexorgien. Und damit nicht genug. Sie bauten sich auch noch seltsame, weiße Tüten, die sie dann sogar rauchten! Kaum verwunderlich, dass der Strand irgendwann den Namen „Schweinebucht“ bekam. Wohl das Einzige, was den tief religiösen Gomeros zu den zottelig, nackten Menschen und der mit ihnen einhergehenden Rattenplage einfiel. Doch die Zeiten des „Sodom und Gomera“ sind vorbei. Heute gibt es nur noch vereinzelt Esoteriksüchtige und Ewig-Hippies auf der Insel. Die Blumenkinder von gestern kommen heute mit Laptop und Anzug auf die Insel. Und diejenigen, die hängen geblieben sind, haben sich auf der Insel zu erfolgreichen Unternehmern gemausert. So wie Capitano Claudio, den ich später noch treffen werde.
Ein lebendes Lexikon
Vor uns liegt Santiago. Der sonnensicherste Ort im Süden der Insel. Das kleine Fischerdorf gilt als einer der besten Startpunkte für Wanderer. Trotz des Tourismus hat es sich seinen eigenen Charme und dörflichen Charakter bewahrt. Ein ungeschriebenes Gesetz auf Gomera. Sanfter Tourismus wird auf der Insel großgeschrieben. Da machen auch die Unterkünfte keine Ausnahme. Sei es in den kleinen, privaten Appartements oder aber auch im besten Hotel Gomeras, dem liebevoll restaurierten Parador hoch oben über San Sebastian.
Feuriger Gigant
Vom kleinen Weiler Agalàn aus machen wir uns auf den Weg zu einem sagenumwobenen Gewächs: Dem Drachenbaum. Der Weg führt vorbei an Kanarischen Dattelpalmen und Mandelbaumplantagen vergangener Tage. Steil abwärts geht es durch Kakteenfelder und Wolfmilchgewächs. Ich schramme mir das Knie, doch Christobal ist auf jeden Unfall vorbereitet, hat sofort ein Pflaster parat. Und dann stehen wir vor ihm: El Drago, der Drachenbaum. Der grüne Riese ist der einzige seiner Art auf Gomera. Früher gab es ganze Drachenbaumwälder, doch dann fielen sie dem Kahlschlag zum Opfer, wichen Zuckerrohr und Bananenplantagen, um die Konjunktur der Insel anzukurbeln. Niemand weiß, wie alt der archaische Gigant heute ist. Die Gomeros schrieben ihm locker bis zu 4.000 Jahre auf den Buckel. Vielleicht weil er schon immer heilig für sie war. Früher schmückte sein Bild sogar die kanarischen Peseten. Mag der Euro sein Bildnis auch verdrängt haben, die Natur überlebte das Kapital. Inzwischen wurden weitere Dragos auf Gomera angepflanzt, doch bis sie einmal die stattliche Größe ihres Vaters in Agalàn erreicht haben, mag noch viel Atlantik die Insel umspülen.
Es grünt so grün…
„Willkommen in Hermigua, wo wir das beste Klima der Welt haben“. So bescheiden grüßt das kleine Dorf im Norden der Insel. Doch die kesse Behauptung stimmt weiß Gott. Wir holen tief Luft, genießen die kühlen Temperaturen und hören den Atlantik gegen die Klippen krachen. Die Wolken hängen längst nicht mehr nur am Himmel, haben es sich im Tal bequem gemacht. Es scheint bizarr, dass rundherum kanarische Bananen, Weintrauben und Gemüse auf den steilen Terrassenebenen wachsen. Als wollten sie der Sonne entgegen gehen, ragen die Felder stufenartig den Berg herauf. Erreichen werden sie den Feuerball wohl nie, und auch die Sonnenstrahlen haben Mühe, die dicken Wolkendecken zu durchdringen. Dass Hermigua trotz des mangelnden Sonnenlichts dank seiner reichhaltigen Ernte zu den wichtigsten Gemeinden der Insel gehört, ist kaum vorstellbar. Doch die sattgrüne Pracht des Tals spricht für sich.
„Fabel“haftes Naturerlebnis
Je tiefer wir in den Nationalpark vordringen, desto weniger können wir sehen. Dichte Nebelschwaden sind heraufgezogen, die Sicht beträgt nur noch gut 20 m. Der „feuchte Atem Gottes“ umfängt uns. Der Passatwind, der Wolken und Regen nach Gomera bringt und diese einzigartige Flora nicht verdorren lässt. Farne und Blätter saugen wie Schwämme die Feuchtigkeit auf, tropfen auf die Wege und unsere Köpfe. Unsere Regenjacken sind klitschnass. Um uns herum Lorbeerwälder, moosbewachsene Äste, Flechten und Erika, soweit der Blick noch reicht.
Pfiffiges Inselleben
Von
irgendwo her ertönt ein Pfeifen. Lang gezogen und dann
im schnellen Stakkato-Rhythmus. Die Pfiffe klingen unmelodisch,
die Rhythmen unregelmäßig. Vor uns öffnet
sich das „Valle Gran Rey“, das „Tal des
Großen Königs“. Wahrhaftig, ein hoheitliches
Tal. War Hermigua schon imposant, so fehlen uns hier gänzlich
die Worte. Obst- und Gemüseplantagen erstrecken sich
bis zur Küste, meterhohe Weihnachtssterne räkeln
sich an den Hängen, und die Sonne taucht das Tal in
ein glitzerndes Grün. Selbst den Atlantik können
wir von hier oben sehen, und in der Ferne schimmert die
Küste von La Palma. Kaum zu glauben, dass wir kurz
zuvor noch in dicken Nebelschwaden standen.
Wieder hören wir das Pfeifen. Und mit einem Mal sehen
wir, woher es kommt, werden Zeugen einer der ältesten
Kommunikationsformen der Insel: Dem El Silbo. Unweit von
uns entfernt steht ein Ziegenhirte. Zwei Finger steckt er
in den Mund, mit der anderen Hand formt er einen Schalltrichter.
Und dann geht es los. Er pfeift eine Art Melodie, einen
Code, den keiner von uns versteht. Kurz darauf ertönt
ein anderer Pfiff. Weit entfernt, und dennoch hörbar.
Auf der anderen Seite des Tals erkennen wir einen kleinen
Punkt. Als wir genauer hinschauen, sehen wir einen zweiten
Hirten, dicht an die Felswand gepresst. Er antwortet! Durch
weit verstreute Siedlungen, unüberwindbare Bergrücken
und ein kaum vorhandenes Verkehrsnetz waren die Gomeros
lange Zeit darauf angewiesen, sich auf andere Art zu verständigen.
Ob neuester Klatsch oder wichtige Informationen, die Einheimischen
pfiffen es sich zu wie die Spatzen von den Dächern.
„Bis heute versuchen die Gomeros diese Sprache am
Leben zu erhalten, denn die neue Handy-Kultur hätte
El Silbo fast zum Aussterben gebracht“ erzählt
Christobal. Die Pfeifsprache wurde inzwischen als Pflichtfach
in den Schulen eingeführt, und die Unesco adelte auch
hier „Naturerbe der Menschheit.“
Der Abstieg ins „Valle“ ist mühsam, doch
schließlich ist es geschafft. Das Tal ist der beliebteste
Treffpunkt deutscher Touristen. Hier gibt es die sichersten
Strände, und in Vueltas kann man sogar so was wie Nachtleben
genießen. Für mich wird es Zeit für einen
letzten Besuch bei Capitano Claudio. 10 Jahre haben wir
uns nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie es ihm heute
geht. Der deutsche Aussteiger ist das Original im „Valle“.
In seinem kleinen Laden verkauft er Anglerzubehör,
organisiert Schiffsfahrten, Delphin-Touren und unterhält
mit allerlei Seemannsgarn. An seinem „Valle-Boten“,
der einzigen deutschsprachigen Inselzeitung, kommt niemand
vorbei. „Unabhängig, überparteilich, abgedreht“
und mit Erscheinungsweise „nach Bock und Wetterlage“
informiert er über die Insel-News. „Schön,
Dich zu sehen“. Der weißhaarige Seebär
umarmt mich überschwänglich. Ein Gesicht vergisst
er niemals. „Komm rein. Du bleibst doch zum Essen?“
Bei Papas arrugadas mit scharfer Mojo-Sauce und einem eiskalten,
hochprozentigen „Gomerón“ lassen wir
uns in die Nacht fallen.
Es gäbe noch viel zu erzählen, von dieser kleinen
Kanareninsel. Von Agulo mit seinen pastellfarbenen Kolonialbauten.
Von Vallehermoso und seinem „Miel de Palm“.
Oder vom Fortaleza, dem Tafelberg Gomeras. Pendant des Ayers
Rock in Australien und größte Kultstädte
der Guanchen. Doch für Gomera braucht man Zeit. Viel
Zeit. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. „Mañana“
– wie der Spanier sagt.